- Tierarten auf der Welt: einige Millionen (1 Mio. bekannt)
- Einteilung in ca. 35 Stämme, davon 9-10 wichtige (Klett 2 Kap. 101)
1 STAMM URTIERE
- ca. 20'000 Arten
- Einzeller
1. 1 Klasse Wurzelfüsser (Klett 2 Kap. 57)
1. 1. 1 Wechseltierchen
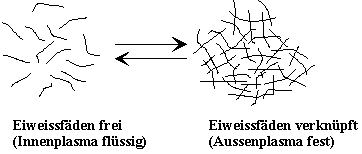
- Keine Organellen im Aussenplasma
- Nahrungsbläschen hat die Funktion eines Darmes
- Atmung über die ganze Körperoberfläche
- Pulsierendes Bläschen hat die Funktion einer Niere
- Wasser, das unkontrolliert eindringt (Brownsche Molekularbewegung), wird vom
pulsierenden Bläschen nach Aussen befördert
Auch andere Zellen können herumkriechen (z.B. Weisse Blutkörperchen)
- Ergänzung zum Buch
- Die Ruhr (starker Durchfall, Klett 2 Kap. 57)
- Verdrocknungsgefahr
- Wasser+Salze (Tabletten) einnehmen
1. 2 Klasse
Wimpertierchen (Klett 2 Kap. 58)Wimperhaare kann man vergleichen mit Haaren
in der Luftröhre (Fortbewegungsmittel)
1. 2. 1
Pantoffeltierchen
- Pulsierende Bläschen
- bei Fortbewegung: Drehung um eigene Achse
- Wimperhaare dienen auch für die Nahrungsaufnahme
- schleudert bei Bedrohung Eiweissfäden (Trichocysten) ab
1. 2. 2
Glockentierchen
1. 3 Klasse
SporentiereSporentiere sind Parasiten
1. 3. 1
Malariaerreger (Klett 2 Kap. 25)
- Malaria (it. schlechte Luft ==> Sumpfgas)
- Malariaerreger zerstören rote Blutkörperchen + Stoffwechselgifte
- nur in der Mücke geschlechtliche Vermehrung
- alles haploid, ausser bei der Verschmelzung
- kein Impfstoff
1. 4 Klasse
Geisseltierchen (Klett 2 Kap. 100/101)auch: Geisselträger
Entwicklungsstufe zwischen Tier und Pflanze
==> kann nicht leicht unterschieden werden
1. 4. 1
Augentierchen (Klett 2 Kap. 53)
- Augentierchen hat keine Zellwand, aber Chlorophyl
- ==> müsste Tier und Pflanze sein ?!?
1. 4. 2
Chlamydomonas
1. 4. 3
Schlafkrankheitserreger (Klett 2 Kap. 25)
- rein tierische Geisselträger
- kein Chlorophyl
- Parasit
- wird durch Insekt übertragen (Afrika)
1. 4. 4
Naganaerreger (Klett 2 Kap. 25)
2 STAMM SCHWÄMME
(Klett 2 Kap. 101)ca. 500 Arten
meist marin
z.B. Badeschwamm, im Süsswasser Süsswasserschwamm
Grundaufbau:
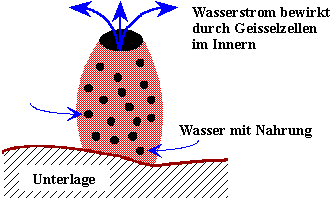
- einfache Form: "Schlauch" mit Skelettstütze
- nur wenige verschiedene Zelltypen
- Skelett: Horn oder Kristalnadeln
3 STAMM HOHLTIEREca. 9000 Arten
meistens marin, wenige im Süsswasser
Grundaufbau eines Polypen:
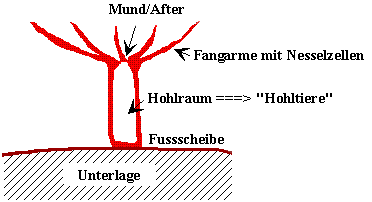
- Blumentiere (Seeanemonen) sind ähnlich gebaut
3. 1 Klasse
Süsswasserpolypen (Klett 2 Kap. 58/59)2 Zellschichten: Aussenhaut (Ektoderm),
Innenhaut (Entoderm)
Nesselkapseln
- berührungsempfindlicher Fortsatz
- Schlauch ist eingestülpt
- enthält giftige Füssigkeit
- Tier wird gelähmt
- Kapsel muss neu gebildet werden
- ==> Ersatzzellen
- Beute verdauen (Klett 2 Kap. 72 Abb. 3/4)
- können sich nicht allzugut fortbewegen
- Nesselkapsel: Abwehr gegenüber Feinde
| Symbiose (Klett 2 Kap.
83/84): 2 Arten profitieren voneinander (++) |
Flechten:
- Bioindikator (z.B. Flechten zeigen Luftverschmutzung an)
- Bodenbildung (zersetzen Gestein)
3. 2 Klasse
Blumentiere
3. 3 Klasse
Quallen/Medusen (Klett 2 Kap.60)Fortbewegung: Wind (passiv) und
Rückstossprinzip (aktiv, durch zusammenziehen).
Grundaufbau:
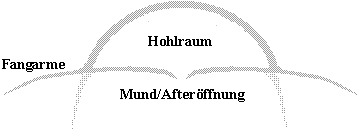
Generationswechsel:
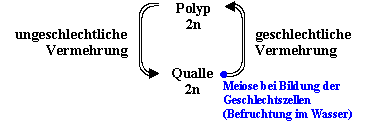
- beide Generationen: diploid
- ungeschlechtliche Fortpflanzung durch Abtrennung des oberen Teils des Polypen vom Fuss
- ==> neue Qualle
3. 4 Klasse
KorallenPolypen, die durch Knospung gewachsen sind,
sich aber nicht abgetrennt haben
Alle Polypen auf einem Korallenstock haben das gleiche Erbmaterial
Ektoderm scheidet Kalk aus ==> Kalkskelett
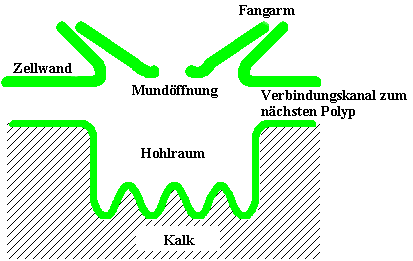
- Ursprung: Einzelpolyp
- Korallen ==> Riff ==> Atoll (abgesunkener Vulkan)
4 STAMM
PLATTWÜRMER (Klett 2 Kap.101)ca. 15000 Arten
zwittrig
Tiere sind abgeplattet
einfach gebaut
komplizierte Fortpflanzungsorgane
Ektoderm, Entoderm + Mesoderm
Mesoderm: Zwischenschicht
4. 1 Klasse
Strudelwürmer (Klett 2 Kap. 75 Abb. 1)frei lebend im Wasser
4. 2 Klasse
Bandwürmer (Klett 2 Kap. 82)Innen-Parasiten
Glieder: zuerst männl., dann weibl.
neue Glieder werden hinter dem Kopf gebildet
Hauptwirt: In ihm findet die geschlechtliche Fortpflanzung statt
Zwischenwirt (Nebenwirt)
4. 2. 1
Rinderbandwurm
4. 2. 2
Schweinebandwurm
4. 2. 3
Fuchsbandwurm
4. 2. 4
Hundebandwurm
- Mensch kann Zwischenwirt sein
- Im Hund (Hauptwirt) nur ca. 3-4 mm lang und hat 3-4 Glieder
- Finen entwickeln sich in der Leber von Kleinsäugern, Schaf und Schweine
- Finengrösse: Tauben- bis Hühnerei
- im Zwischenwirt ungeschlechtliche Vermehrung ==> viele kleine Finnen
- wenn Mensch Zwischenwirt ist, bis zur grösse eines Kindskopfes und kann sich auch in
anderen Körperteilen als in der Leber entwickeln
4. 3 Klasse
SaugwürmerInnen-Parasiten
4. 3. 1 Kleiner
Leberegel
- pro Miracidien ca. 10'000 Cercarien ==> Wahrscheinlichkeit grösser für
Weiterverbreitung
- Ganglion (Klett 2 Kap. 4)
- Umprogrammierung dass sich die Ameise in die Höhe begibt und sich festbeisst
- Ameise braucht es dass sie die Cercarie in die Höhe des Abweidungsbereiches
- bringt und für gute Verteilung (Wirt darf nicht sterben)
- alles Blut vom Darm muss durch die Leber (Pfortader) fliessen
- in Leber entwickelt sich die Cercarie in 3-4 Monaten zu einem Leberegel
- ==> Leberegel legungsreif
- wandert zum Gallengang und gibt Eier ab
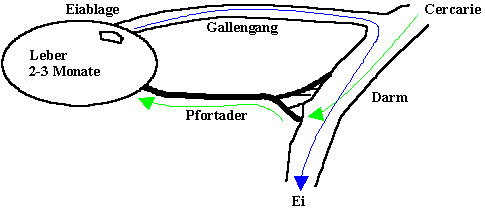
4. 3. 2 Grosser
Leberegel
- nur 1 Zwischenwirt
- Larven können sich bewegen ==> grössere Wahrscheinlichkeit
- ==> braucht nicht so viele ungeschl. Fortpflanzungen und Ameise nicht nötig
- Problem: Fast keine Sumpfwiesen mehr
- Kleiner Leberegel ist Weiterentwicklung vom grossen Leberegel
4. 3. 3
Schistosoma, Bilharzia
- Krankheit: Schistosomasis, Bilharziose
- nicht zwitterig
- Mensch Hauptwirt
- Wasserschnecke Zweischenwirt
- ca. 120 Mio Menschen betroffen in trop. Gebieten die bewässert werden
- Tropenkrankheit
- Larve kann durch die Haut in den Menschen
- gehen in:
- Blase ==> Blasenentzündung
- Leber ==> Leberentzündung
- Darm ==> Ruhr
- Gegenmassnahme: Kot und Urin nicht direkt ins Wasser (Aufklärung)
- bei uns gibt es auch Schwanzlarven die Fische befallen
- bei Menschen nur Hautentzündung
5 STAMM
RUNDWÜRMER/FADENWÜRMER (Klett 2 Kap.101, Kap. 82)runden Querschnitt
ca. 12'000 Arten
viele davon Parasiten
andere leben im Wasser oder feuchten Erde (Aelchen = Wurzelschädlinge)
5. 1 Klasse
Trichine (Klett 2 Kap. 82)Man bekommt Trichinen, wenn man
trichinöses, rohes Fleisch ist.
Schweinefleischlos: Islam, Juden (ev. biologischer Einfluss)
5. 2 Klasse
Spulwurm
Entwicklungsgang des Spulwurmes im Körper
des Menschen:
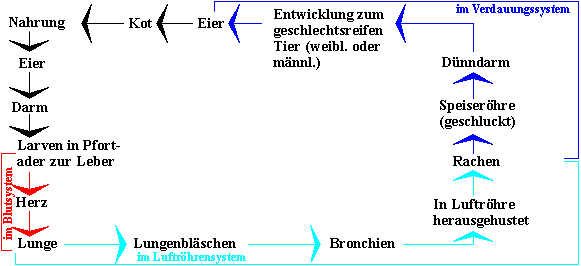
5. 3 Klasse
MadenwurmVerbreitung durch Kot
6 STAMM
RINGELWÜRMER (Klett 2 Kap. 101)ca. 7000 Arten
3 Klassen: Wenigborstige, Egel, Vielborstige
Strickleiterförmiges Bauchmark auf der Unterseite des Körpers
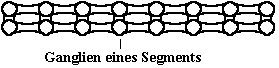
6. 2 Klasse Egel
6. 2. 1 Blutegel
- lebt im Wasser
- besitzt 2 Saugnäpfe
- Blutgerinnugshemmende Stoffe (Heparin)
- ==> Gefahr von Trombose verringern
6. 3 Klasse
Wenigborster
6. 3. 1Regenwurm (Klett 2 Kap. 66)
- besitzt 10 Herze
- durch Auflockerung des Bodens kann Sauerstoff zu den Wurzeln der Pflanze vordringen
- Blätter werden hineingezogen, dass sie durch Bakterien schneller abgebaut werden
- Fortbewegung durch abwechslungsweises Zusammenziehen der Ringmuskeln oder Längsmuskeln
- Borstenhaare dienen als Halterung
6. 4 Klasse
Vielborstermeistens im Meer
7 STAMM
GLIEDERFÜSSER (Klett 2 Kap.101)ca. 1,5 - 2 Mio Arten
strickleiterförmiges Bauchmark
Gliederung des Körpers
werden manchmal mit den Ringelwürmer in einem Stamm zusammengefasst (Gliederung)
==> Name: Gliedertiere (Gliederfüsser, Ringelwürmer sind Unterstämme)
erster Stamm mit grösserer Unabhängigkeit gegenüber Feuchtigkeit
Aussenskelett ("Panzer") mit einer festen Schicht überzogen
==> Gefahr kleiner auszutrocknen
4 Klassen: Krebse, Tausendfüsser, Spinnenartige, Insekten
Unterscheidung durch Beinzahl:
- Spinnen: 8
- Insekten: 6
- Krebse: meist 10
- Tausendfüsser: über 30
- jedes Segment hatte Beine (heute zurückgebildet)
- ==> Fühler, Afterfüsse
Vergleich Aussenskelett <==> Innenskelett (Klett 2 Kap. 2 Abb. 5/6):
- bei beiden Beuger- und Streckermuskeln
- Innenskelett:
- Muskeln aussen
- schützt besser vor Verletzungen
- Schutz vor Feuchtigkeitsverlust
- Hautatmung nicht möglich
- ==> Atmungsorgane
- Wachstumsprobleme (keinen zusätzlichen Platz für Muskeln) ==> Häutung
- Bei Häutung nur weiche Haut, nehmen Flüssigkeit auf,
- Haut erhärtet zu einem harten Panzer (in dieser Zeit verletzlich ==> Schutz in
Versteck)
- Körperlänge:
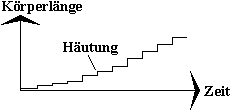
Chitin:
- sehr widerstandsfähiges Material
- schlecht Verdaulich
- ähnliche Funktionen wie Zelluose
7. 1 Klasse KrebseWassertiere
Kiemenatmung (Feuchtlufttiere)
Unterscheidung Krebs <==> Skorpion:
- Krebs: Scheren sind Beine
- Skorpion: Scheren sind Mundwerkzeuge
7. 1. 1 Flusskrebs
(Klett 2 Kap. 67)
7. 1. 2 Krabben
(Klett 2 Kap. 67 Abb. 3)
7. 1. 3 Seepocken
7. 1. 4 Garnelen =
Crevetten
7. 1. 5 Asseln
(Klett 2 Kap. 48 Abb. 11)
7. 1. 6 Wasserfloh
- ca. 0,5 mm gross
- Fühler dienen als Fortbewegungsmittel und Beine zum Herbeistrudeln der Nahrung
7. 2 Klasse
Tausendfüsser
2 Formengruppen:
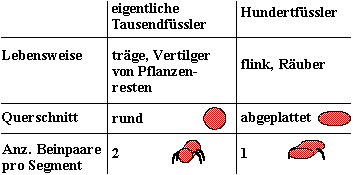
- Tausendfüsser produzieren Giftgas (Blausäure)
7. 3 Klasse
Spinnenartige (Klett 2 Kap. 68)Spinnen haben bis zu 8 Augen
7. 3. 1
Wespenspinne, Zebraspinne
- Bioindikator
- nur Heuschrecken als Nahrung ==> kein Vorkommen in überdüngten Wiesen
- weisses Band im Netz, soll Grashalm simulieren (Heuschrecke will sich festhalten)
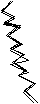
7. 3. 2
Springspinne
- Augen vorne ==> bessere Distanzabschätzung
7. 3. 3
Wasserspinne
- Luftglocke zum Atmen
- verzehrt Beute in Luftglocke
andere Spinnen nützen Oberflächenspannung des Wassers aus
3 Ordnungen:
- Kreuzspinne (Klett 2 Kap. 68 Abb. 1)
- Wolfsspinne (Jäger, bauen kleine Netze)
- Weberknecht (Klett 2 Kap. 68 Abb. 6, fressen tote Insekten)
- Vogelspinne
- nachtaktiv
- Raubtiere
- besitzen giftigen Stachel am Schwanzende
- im Tessin gibt es auch kleine Skorpione
- Milben können Schädlinge bei Tieren oder Pflanzen sein
- z. T. können sie auch Raubtiere sein
- Zecken können Hirnhautentzündung übertragen
- Öl oder unverdünntes Kamilosan, danach rausdrehen
7. 4 Klasse
Insekten (Klett 2 Kap. 1-26)
Übersicht auf Seite 26
Schmetterlinge (Klett 2 Kap. 9)
7. 4. 1 Admiral,
Distelfalter
7. 4. 2 Kleiner
Fuchs, Tagpfauenauge
- Raupen brauchen Brennessel (Nahrung)
- ==> wenn Futerpflanze fehlt, können sie nicht überleben
7. 4. 3
Zitronenfalter, Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge
- überwintern als Falter (verpuppen sich nicht im Winter)
7. 4. 4 Bläulinge
- Bioindikator ==> brauchen viele Blütenpflanzen
7. 4. 5
Blutströpfchen (Klett 2 Kap. 10 Abb. 4)
7. 4. 6
Kleidermotten (Klett 2 Kap. 10 Abb. 11)
- nur Raupen ernährt sich von Kleidern (Wolle)
7. 4. 7 Totenkopf
(Klett 2 Kap. 10 Abb. 3)
Bienensprache (Klett 2 Kap. 13):
- senkrecht nach oben heisst in Richtung der Sonne (Klett 2 Kap. 13 Abb. 5-7)
- Duft beschreibt Futerpflanze
- Richtung, Distanz, Art der Futerquelle wird angegeben
7. 4. 8 Wespen und
Hummeln (Klett 2 Kap. 16)
- Hummeln haben Pelz (Isolation) ==> Bestäubungsaktivität auch bei tiefen
Temperaturen
- Hornissen sind nachtaktiv
Blattlausfeinde:
- Florfliege
- Marienkäfer-Larve
- Schwebefliegen-Larven
- Schlupfwespe
7. 4. 8
Blattläuse (Klett 2 Kap. 22 Abb. 10)
Schädlingsbekämpfung (Klett 2 Kap. 23):
- DDT ==> Stoffwechselprobleme ==> z.B. zu weiche Vogeleierschalen
- Nützlinge werden auch vernichtet
- Wasserverschmutzung (Grundwasser)
- Abbauzeit und Abbauprodukte gefährlich
- Resistenzprobleme können auftreten
- weniger Monokulturen, sondern Mischkulturen ==> grössere Entfernungen
- gleicher Pflanzenarten
- optimale Haltung (Widerstandskraft grösser)
- Wahl von resistenten Sorten
- Hecken und andere Naturlebensräume als Refugien für Schädlingsfeinde
7. 4.
9 Läuse und Flöhe (Klett 2 Kap. 24) |