- feiner Schnabel ==> feine Beute
- grosse Augen ==> Beutesuche in Dämmerung
Greift rote Attrape an (Revierverteidigung) ==> nur rotgefärbte Federn werden
verarbeitet
Gründe:
- Einfache erbliche Abspeicherung
- Längere Reaktionszeit je präziser der AAM ist und je mehr Reize verglichen werden
müssen
| Fehlreaktionen
sind grundsätzlich möglich. |
2. 3. 7 Klassische Fehlreaktionen (433.1, 433.2)
Ragwurz (Ophrys) ==> Orchideen:
Die Blüten ähneln bestimmten Insektenweibchen. Ein vorbeifliegendes Insektenmännchen
meint die Blüte sei ein Weibchen, will sich mit ihr paaren und erhält somit Blütenstaub
auf den Kopf. Schliesslich gibt es auf, fällt aber bald wieder auf so eine Blüte herein
und überträgt die Pollen ==> Nutzung des Paarungsverhalten von Insekten
Vorkommen: Magerwiesen (sehr verstreute Standorte).
- Da Ragwurz sehr verstreut vorkommt, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr klein, dass eine
Honigbiene wieder zu einer Ragwurz geht ==> Negativ für Pflanze:
- Pflanze abhängig vom Vorkommen der Insektenart
- Pflanze muss blühen, wenn Insektenmännchen in Paarungsstimmung sind
Bemerkungen:
- Schwankung der Population von Insekten (Bsp. Stubenfliegen (76.1)). Gründe: Klima hat
sehr starke Auswirkungen
- Bei einjährigen Pflanzen ist diese Methode nicht gut möglich
- Ophyrys darf keinen Nektar haben, da sonst die Insekten mit schlechter
Bestäubungseffizienz die Pollen wegtragen würden
- Bsp. AAM für mehrere Insektenarten ==> Mischpaarungen zwischen Insektenarten (nicht
möglich)
- Bsp. mehrere Ophrysarten pro Insekt ==> Mischungen, Bastardbildung (Kreuzung zweier
Arten) (möglich, Bsp. Mittelmeergebiet)
- Keine Vorteile für Insekten
- Nachteile:
- Zeitverlust für Insekten nur klein, da Männchen 2 Tage früher schlüpfen als Weibchen
(Selektionsdruck, da für Weibchen Paarung nur einmal möglich ==> eher früher
schlüpfen, als später)
Zwischenkapitel
Bestäubungsbiologie
| Generelles Ziel: Mit möglichst grosser
Wahrscheinlichkeit sollen Pollen auf die Narbe einer artgleichen Blüte gelangen |
- Windbestäubung ==> viel Pollenstaub
°
°
- Entwicklung
°
°
- Tierbestäubung (Tiere ursprünglich Pollenräuber)
1 Anpassungen im Blütenbau
1. 1 Akelei
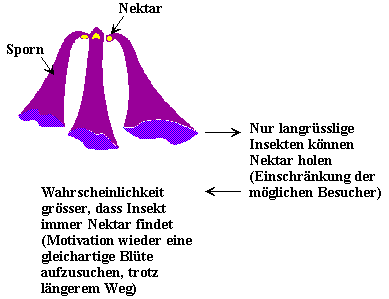
- Ausnahme: Hummeln beissen Sporn auf und saugen Nektar aus ==> keine Bestäubung
1. 2 Bestäubung durch Vögel
- Honigsauger (Vorkommen Australien)
- Nektarvogel (Vorkommen Afrika, Asien)
- Kolibri (Vorkommen Amerika)
1. 2. 1 Kolibri
Fliegen bei Nektaraufnahme ==> Blüte muss freistehend sein
andere: Brauchen Sitzgelegenheit (Stengel)
- Röhrenförmige, rote Blüten sind typisch für Vogelbestäubung
- Grund: Insekten sehen rote Blüten nicht gut
1. 2. 2 Nektarvogel
- Reife Blüten hängen herab
- Bestäubte Blüten fallen ab
- Fruchtknoten muss robust sein (Krallen des Vogels)
Farbe, Duft ==> Versprechen (Anlockung)
1. 3 Zeitliche Eingrenzung des Blühens
2 mögliche Eingrenzungen:
- tageszeitlich
- jahreszeitlich
1. 3. 1 Wegwarte
- Blüht vor allem am Morgen
- Jeden Tag neue Blüten
1. 3. 2 Weinbergtulpe
- Von den Römern (Mittelmeer) gebracht
- sehr selten, fast nur noch vereinzelt in Weinbergen zu finden
- Blüten öffnen sich jeden Nachmittag, während sie am Morgen geschlossen bleiben
- Zweck: Der Prozentsatz der gleichartigen Blüten wird grösser zu einem gewissen
Zeitpunkt (Blumen dieser Art, welche am falschen Zeitpunkt blühen, haben fast keine
Chance ihr Erbgut weiterzugeben)
- Grundsätzlich müssen sie aber immer dann Blühen, wenn es Insekten hat
- Grenze Herbst: Samenbildung, ev. Samenverbreitung muss vor dem ersten Frost beendet sein
1. 3. 3 Herbstzeitlose
- Blüht im Spätherbst + Befruchtung im Herbst
- Samenbildung erst im Frühling unter der Erde
- Giftig ==> Pflanze wird im Winter nicht angefressen
Im Gebirge ist Vegetationsperiode kürzer
==> mehr Konkurenz
==> mehr Pflanzenarten müssen miteinander Blühen ==> Blume muss farbenprächtiger
sein, dass sie angeflogen wird
1. 3. 4 Blütenkerzen, Blütenkörbchen
| Ziel: Möglichst viele gleichartige Blüten beisammen
==> Insekt geht eher wieder auf eine gleiche Blüte Wenn Insekt für eine gewisse Zeit
immer auf die gleiche Art geht, ist er Blütenkonstant (Bsp. Honigbiene) |
1. 3. 5 Rosskastanie
- nicht alle Blüten haben rote Punkte
- Signalisation für Insekt, bei welchen Blüten noch etwas zu finden ist
- Wechsel gelb zu rot
- Grund: Rot ist für Insekten nicht attraktiv
- Nach Bestäubung behält die Pflanze die Blüten in der ursprünglichen Form bei
- Grund: Bestäuber müssen von Weitem angelockt werden, dass die vielen Blüten bestäubt
werden (Fernwirkung der Blüten)
- Später Fernwirkung nicht mehr nötig ==> Blüten fallen ab
Blüten die schon bestäubt sind produzieren keinen Nektar mehr, somit wird die
Effizienz kleiner (weniger interessant für Insekt) ==> Farbwechsel.
1. 3. 6 Lantana (Wandelröschen)
- Balkonkistchenpflanze
- Ursprung: Tropische Länder
- sehr klein (braucht keine Fernwirkung)
- Wechsel:
| rot |
zu |
gelb |
zu |
rot |
| ungeöffnete Blüte |
|
zu bestäubende Blüte |
|
bestäubte Blüte |
- Grund: Rote Blüten dienen als Sitzgelegenheit, da sonst die zu bestäubende Blüte
abknicken würde und der Insekt auf der Öffnung sitzen würde
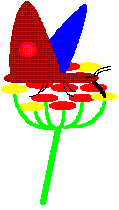
1. 3. 7 Vergissmeinnicht
- Wechsel blau zu violett (Rotkomponente)
Ende Zwischenkapitel
2. 4 Instinkte beim Menschen
- (Bsp.: siehe Appetenzverhalten)
- Instinkte beim Nahrungserwerb
aber: Instinkte + Lernverhalten integriert (Bsp. Kühlschrank)
- Instinkte häufig im Fortpflanzungsbereich
2. 4. 1 Aussagen von K. Lorenz:
"Kindchenschema" (278):
- AAM für Kleinkinder
- Gilt auch für Tiere
- Merkmale: Runder Kopf: fliehender Kinn, steile Stirn, Stupsnase, Pausbacken; Grosse
Augen
- Kindchenschema ist der AAM für Brutpflegeverhalten,
- Beschützerverhalten
2. 4. 2 Wie reagieren Männer auf den weiblichen Körper?
Eigenschaften:
- lange Beine
- breite Hüfte
- schmale Taille
- Brüste
- Hautfarbe (kulturell bedingt)
- Haare
- Gesicht (ev., gilt nicht generell)
- glänzende Haut
- glatte Haut (Muskeln unbetont)
- unweiblich: Schultern sind breit
Gründe:
- Geburtskanal muss genügend gross sein ==> breites Becken
- Heute spielt das keine Rolle mehr (Kaiserschnitt)
- Die AAM der Männer, welche breithüftige Frauen bevorzugen, werden sicherer
weitergegeben
- Rückschluss auf Alter ==> Jugendlichkeit
- früher Lebenserwartung ca. 30 Jahre
==> zu alte Frau ==> Wahrscheinlichkeit gross, dass Kind ein Waise wird +
zusätzlich mehr Kinder möglich
- heute Lebenserwartung grösser
- ==> Mann sollte Jugendlichkeit ansprechen:
- Haare
- glatte Haut
- Gesicht
- schlanke Taille
- Männer haben breitere Schultern, da breite Schultern = mehr Kraft (früher Jäger)
- Hinweis, ob Frau Schwanger ist
- Merkmale eines pupertierenden Mädchens
- ==> lange Beine unverhältnismässig gross zum Körper
- ==> jung, Wahrscheinlichkeit klein, dass diese schwanger ist
- ==> "Reservierung"
| allg: Erbanlagen, die dazu führen, dass etwas
sinnvolles bevorzugt wird, werden eher über Generationen weitergetragen. |
==> unbewusstes Interesse
Bemerkungen:
- Flexiblität der Männer
- Optische Merkmale sind nicht allein massgebend
2. 4. 3 Reaktion der Frau
- Männer inverstieren bei Geschlechtsverkehr weniger
- Investition für Frau nur gut, wenn Kind überlebt ==> Mann muss helfen
- ==> Das Optische hat nicht den gleichen Wert bei der Frau (Hemmungen, da Investition)
- Bem: positiv: Frau weiss, dass Kind ihres ist, für Mann aber unsicher, ob Kind seines
ist
2. 4. 4 Verhaltenselemente, auf die die Menschen
reagieren
- Einladung zum Geschlechtsverkehr durch hinhalten des Hintern (Bsp. Affen: geschwollenes
Hinterteil) ==> bei Menschen noch heute vorhanden
- Bememerkungen:
- Bei Affen kann es auch Friedensangebot sein ==> Weibchen entgehen
- Züchtigung ("Auf andere Gedanken bringen")
- Ausgeprägter Hinterteil bei einigen Affenarten auch beim Männchen
- ==> Sex und Gewalt liegen sehr nahe beieinander (Vergewaltigung: Machtdemonstration)
- Blick ==> Aufforderung zum Mitkommen
2. 5 Balz
| Balzhandlungen haben den Zweck, dass es zu einer Paarung
führen soll. Vergleichbare Wörter: Brunft, Ranz... |
Beispiele:
- Pfau: Rad
- Birkhuhn: hängende Flügel
- Paradisvogel: an Ästen herunterhangen
Sinn:
- Werbung um das Weibchen (Imponieren)
- Männchen liefern über die Balz Anhaltspunkte dem Weibchen zur Auswahl
2. 5. 1 Balzhandlungen, bei denen Männchen nicht bei der
Aufzucht helfen
Weibchen muss selber Junge aufziehen ==> falls Erbanlagen des Männchens schlecht
sind ==> Chance kleiner für Weitergabe seiner Erbanlagen (Bsp. Feldhasen)
Bsp. Birkhuhn:
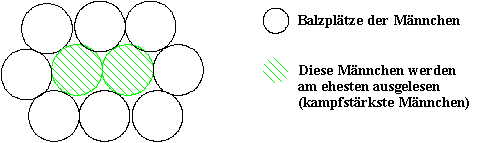
Bsp. Pfau:
bei intaktem Rad Hinweis für Weibchen auf Unversehrtheit von Raubtieren + Gesundheit
2. 5. 2 Balzhandlungen, bei denen die Männchen bei der
Aufzucht helfen
Bsp. Haubentaucher:
Über Balzhandlungen kann auch die Fortpflanzungsstimmung koordiniert werden ==>
beide wollen im entscheidenden Moment das selbe machen
Auslesverfahren:
- Mithilfe
- Revier (Weibchen lesen zuerst das Revier aus)
2. 5. 3 Balzhandlungen bei Menschen
Bei Menschen zwar Balzhandlungen vorhanden, aber sehr flexibel
- Imponierung durch Auto, ... ===> Geld
- Blumen
Mann trägt auch zur Aufzucht der Kinder bei
2. 6 Handlungsketten
| Instinkthandlungen laufen selten isoloiert ab, sondern
häufig als Kette von Einzelhandlungen zwischen 2 Induvidien. Dabei dient die jeweils
vorhergehende Handlung des einen Partners als Auslöser für die nächst folgende Handlung
des anderen Partners. |
Bsp. Paarungsverhalten beim Stichling (Abb. 281.1 + Kap.
3.2.2.3):
Schnauzentriller:
- Signalisation, dass Männchen bereit ist zur Besamung, denn Eier sind nur kurze Zeit
befruchtungsfähig
2. 7 Allgemeine Besonderheiten der
Instinkthandlungen
vor allem am Beispiel der Balzhandlung
2. 7. 1 Einflüsse von Stimmungsstärke und Reizstärke
(Abb. 280.1)
- Stimmung nimmt zu, je länger es sich nicht paaren konnte
- ==> Stimmungsstärke beeinflusst direkt die Intensität der Handlung
- Je stärker der Reiz, je intensiver die Instinkthandlung
Bsp. Guppy:
- Reizstärke = Grösse des Weibchens
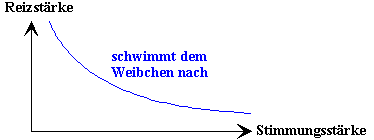
- Je kleiner die Grösse, je stärker muss Reiz sein, oder umgekehrt
- Guppy sind lebendgebährend
Bsp. Austernfischer (Abb. 279.1):
- brütet in Nestmulde
- Ei kann aus dem Nest rollen
- Vogel holt es zurück
- Hier: Bevorzugt grösseres Ei (Attrappe), denn Reiz grösser
==> Übernormaler Reiz wirkt stärker, als der normale Reiz. Im AAM gibt es keine
obere Reizgrenze, ev. Überlagerung durch eine andere instinkthandlung (Fluchtverhalten,
wenn Objekt zu gross)
Bemerkung:
- Auch beim Menschen gibt es übernormale Reize, z.B. Sexidole
- Hafenstadt-Bordelle: Je grösser Stimmung der Matrosen, je kleiner muss Reiz sein
2. 8 Übersprunghandlungen (S. 282)
- Bsp. Enten in Balzhandlung, plötzlich putzt sich Männchen Flügel (<==
Übersprunghandlung)
- Bsp. Amselmännchen trifft anderes Männchen an Reviergrenze ==> Abhalten, dass
anderes Männchen in sein Revier kommt ==> drohen. Plötzlich putzt ein Männchen sein
Gefieder oder pickt Sachen auf (<== Übersprungshandlung)
| Übersprungshandlungen passieren dann, wenn 2 sich
widersprechende Antriebe vorhanden sind. Übersprungshandlungen finden statt in einem
Antriebsbereich, welcher mit den anderen nichts zu tun hat. |
- z. Bsp. Soll ich aufhören oder nicht ? ==> Übersprunghandlung: Federn putzen (keine
Aufmerksamkeit des Weibchens)
- ==> Versuch die Handlungsfähigkeit zu bewahren, indem es zu einer Entblockierung
kommt
- Keine Signalisation in welcher Richtung man tendiert (z.B. ob Flucht oder Weiterkampf)
- Verlegenheitsverhalten
2. 9 Leerlaufhandlungen (S. 282)
- Stimmung genügend gross, dass es keinen Reiz mehr braucht um eine Instinkthandlung
auszulösen
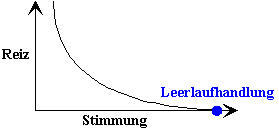
- ==> Appetenzverhalten ==> kann lebensbedrohend sein
- Bei Leerlaufhandlung aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit (verkleinerung der
Stimmung ==> kein Appetenzverhalten mehr)
2. 10 Ritualisierung
Verhaltensweisen können einen Bedeutungswandel durchmachen, vor allem dann, wenn die
ursprüngliche Bedeutung nicht mehr wichtig ist. Häufig werden die Verhaltensweisen zudem
noch abgewandelt.
- Bsp. Balzverhalten bei Hühnervögel (siehe Blatt)
- Bsp. Jungenfütterung:
- Ritualisierung ==> Balzfütterung: Altvogel (Männchen) füttert das Weibchen
Bsp. Seeschwalbe (Fischjäger): Fischübergabe
Grund:
- Männchen zeigt, dass er Nahrung für die Jungen beschaffen kann (Auslesekriterien)
- Grosse Eier vergl. mit Körpergrösse (Abb. 279.1) ==> Energielieferung an das
Weibchen
- Auch für Männchen positiv, denn Weibchen kann mehr Nachkommen produzieren ==>
Erbanlagen des Männchens werden weitergegeben
- Balzfütterung kommt am meisten bei Arten vor, bei welchen das Männchen bei der Auzucht
hilft
Bem: Bei Raubinsekten hat Balzfütterung nichts mit Ritualisierung aus der
Jungenfütterung zu tun
Grund:
- Energielieferant
- Weibchen könnte Männchen als Beute ansehen ==> Vermeidung durch Fresspacket
Bem: Spinnen:
- Gefahr für Männchen gefressen zu werden
- Bsp. Gottesanbetterinnen: Männchen wird während der Paarung aufgefressen ==>
Energie des Männchens kann genutzt werden, da Männchen sowieso keine grosse Chance
gehabt hätte, ein anderes Weibchen zu finden
- Übergabe von Nistmaterial bei Ablösung am Nest
Bsp. Storch, Kormoran: Befriedungsgeste gegen eventuell aufkommende Aggressionen
Grund:
- "Geschenk" ==> Signalisation für friedliche Absicht (Revier)
- Jedes Tier hat eine gewisse Individualdistanz. Falls Individualdistanz zu klein ==>
Abbau der Aggressionen durch "Geschenke"
Bsp. Love-Birds: Es wird kein Futter mehr übergeben
Früher Nahrungsübergabe bei Menschen auch über Mund
- Es gibt auch andere Ritualisierungen: Bsp. Storch: Gruss Ritualisierung aus Drohen
(==> exponieren des Halses)
3 LERNVERHALTEN (S. 283-285)
- auch Erfahrungsbedingtes Verhalten
- Gedächnis
- Unterschied Angeboren <==> Gelernt: Gelerntes ist sogar beim einzelnen Individuum
variabel, während Angeborenes immer gleich ist, ausser bei Erbfehlern.
- Lernverhalten erlaubt dem einzelnen Individuum viel mehr Variablität (Anpassung)
- Erlerntes kann wieder vergessen werden
- Bsp. Eichhörnchen: Öffnen einer Haselnuss
- Bsp. Affenart: Paarungstechnik muss gelernt sein, während sie bei anderen Arten
angeboren ist. (Bei Menschen auch gelernt)
3. 1 Lernen am Erfolg/Misserfolg
- Bsp. Meisen: Picken Aludeckel von Milchflaschen auf und schöpfen Rahm ab
Gründe für Phobie:
- Horrorerzählungen
- Einbildungen
- Verhalten der Eltern
Nasenringe:
- Noch heute bei Stieren voranden (ev. auch bei Schweinen ==> kein wühlen)
3. 2 Prägung
- z. Bsp. auf den Lebensraum
Versuch an Finken:
- Vorkommen in Föhrenwälder
- Aufzucht unter verschiedenen Bedingungen:
| |
Auswahlversuch |
| Föhren |
Eichen |
| ohne Blätter |
x |
|
| mit Föhren |
x |
|
| mit Eichen |
|
x |
- ==> angeborene Komponente + Prägung, die überwiegen kann
- Grund: Anpassung an Umweltverhältnisse
3. 3 Erkundungsverhalten, Neugier- und
Spielverhalten (S. 285)
Erkundungsverhalten: Sich mit der Gegend vertraut machen ==> Fluchtmöglichkeiten,
Verstecke vor Feinden und Nahrungsquellen ausfindig machen
3. 4 Nachahmen
- Nachahmen geht schneller als Lernen am Erfolg / Misserfolg
- Bsp. Wanderfalke: Bewegende Beute ==> wenn falsches Fangverhalten,Gefahr des
Verhungern ==> Nachahmen (schnelles Lernen)
3. 5 Traditionenbildung (S. 287)
- Lernen am Erfolg
- Nichterbliche Weitergabe von etwas, dass sich bewährt hat
Unterschied erbliche Weitergabe <==> nichterbliche Weitergabe:
- Erbänderungen können nicht gezielt ablaufen (sondern zufällig)
- Erbe lässt sich nicht mehr Rückgängig machen (Bsp. Igel: Einrollen vor Auto)
- Erbliche Veränderungen höchstens durch Ausleseverfahren ==> Tote
- ==> Traditionen sind wandelbar (falls es nicht mehr gebraucht wird, kann es
aufgegeben werden)
Bemerkungen:
- Bsp. Früher Häuser an Strassen (Vorteile vom Verkehr), heute Strassen weit weg von
Häuser (Nachteile) ==> Lernen am Erfolg
- Bsp. Igel auf Strasse: Einrollen ist angeboren ==> müsste lernen, nicht auf harte
unterlagen zu gehen. ==> Der Igel könnte sich nicht mehr frei bewegen und seine
Territorien wechseln.
4 SOZIALVERHALTEN (S. 288)
4. 1 Vergesellschaftung
- Einschränkung: Tiere müssen derselben Art angehören
OFFEN
jeder ist akzeptiert |
GESCHLOSSEN
nur wer schon zur Gruppe gehört, wird akzeptiert |
anonym
man kennt sich nicht persönlich |
nicht völlig anonym
man kennt unmittelbare Nachbarn |
anonym
man kennt sich am "Geruch" |
individualisiert
man kennt sich gegenseitig (Rangordnung) |
- Bsp. Honigbienen: Nestgeruch ==> neue Königin muss zuerst in einer
luftdurchlässigen Schachtel in den Stock gelegt werden
- Der Mensch kann sich in jedem Gesellschaftstyp zurechtfinden. (Ursprünglich kannten die
Menschen den Gesellschaftstyp Geschlossen Individualillsiert ==> Sippenschaft)
- Tendenz der Gruppenbildung, z. Bsp. Vereine, ...
- Bei Geschlossenen Gesellschaften Gefahr der Inzucht
Gruss:
- bei Geschlossenen Gesellschaften, z. Bsp. Ameisen: Fühlertriller
- ==> kleines Dorf noch Geschlossene Gesellschaft
Gruppenkennzeichen:
- Geschlossen-Individuallisiert
- "Abschottungsmechanismen"
- Gruppenzusammenhalt festigen
- Kennzeichen:
- Kleider (Uniformen, Frisur, Krawatte)
- Verhalten
- Sprache (Jargon)
4. 2 Rangordnungsverhalten (S. 292)
- Kraft
- Erfahrung
- Anzahl Junge
- Aggressionshemmend
- Aggressionen können Ranghöhere beenden
- Ranghöchstes Alpha-Tier hat den grössten Fortpflanzungsvorteil
- Gruppe wird durch starke Tiere geführt
4. 3 Territoriales Verhalten (Revierverhalten, S.
291)
- Revier ==> Sicherung eines Platzes (Grenzen)
- Individualdistanz ==> Abstand zu Artgenossen
Bemerkung:
- Kot an Reviergrenze ==> zudem Gefahr von Parasiten kleiner
4. 3. 1 Singen eines Vogels
- Drohung an seine Artgenossen, nicht in sein Revier zu kommen
- Sinn: Sicherung der Lebensgrundlage
- bei Überbevölkerung dauernde Revierkämpfe
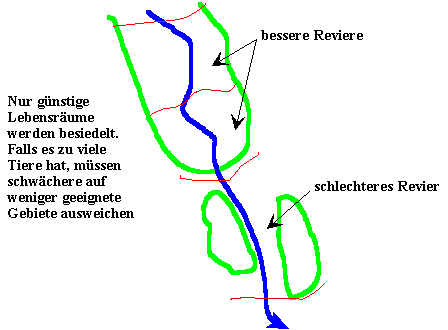
4. 4 Sozialer Stress (S. 300)
- Individualdistanz kann unterschritten werden ==> Aggressionen (z.B. Krawalle vor
allem in Grosstädten)
- bei Unterdrückung der Aggressionen ==> Gefahr für körperliche und seelische
Störungen
4. 5 Sozialbiologische Betrachtungsweise (am
Beispiel der Jungenfütterung, S. 294)
- unbewusster Vorgang
- beim Mensch kann Aufnahme eines Nichtverwandten biologisch sinnvoll sein (z.B.
Altersfürsorge)
Bemerkung:
Pflanzen <==> Pflanzenfresser: Pflanzen können Giftstoffe produzieren, dass sie
nicht gefressen werden. Giftstoffproduktion kostet aber Energie (z. Bsp. Stickstoff). Wenn
sie nicht damit rechnen muss, dass sie gefressen wird, so ist es besser keine Giftstoffe
zu produzieren ==> schnelleres Wachstum möglich (z. Bsp. Tabakpflanze). Bsp. Pfalnzen
die an Orten wachsen, wo es keine Schnecken hat ==> keine Abwehrstoffe gegen Schnecken
4. 6 Verhaltensbiologie des Menschen (S. 295)
4. 6. 1 Vergleich verschiedener Kulturen
- Wegschauen bei Flirt ==> Ritualisierte Flucht
- Anheben der Augenbrauen bei Gruss
- Nicken kommt vom Augenbrauen - Heben (bei weiten Distanzen)
4. 6. 2 Konvergenz (Abb. 153.1)
Unterschied zwischen Kaktus <==> Wolfsmilch: Blüten sind unterschiedlich ==>
Gleiche Anpassung an gleiche Umweltbedingungen von nichtverwandten Arten.
4. 6. 3 Mutter-Kindbindung
- Körperkontakt bei Problemen
- Bindung zur Bezugsperson
- prägungsähnlich, aber sensible Phase ist länger + mehrmaliges Einprägen
- Bezugsperson fördert Erkundungsverhalten
- Sprachliches Erkunden: Mehrmaliges Fragen ==> Sicherheit (nicht abblocken, sonst hat
Kind Probleme)
4. 6. 4 Aggressionsverhalten beim Menschen
- erbliche und erlernte Komponenten
- Sinn: Nützt dem, der Agression ausübt ==> Verbessert Überlebenschancen (Egoismus)
4. 6. 5 Aggressionshemmung
- grösster Teil geerbt
- Aggressionshemmung wird abgeblockt in Kriegen durch Verteufelung der Gegner
4. 6. 6 Rangordnungsverhalten in der Gruppe
- Angst vor Arbeitsverlust
- Meinungsübernahme der Eltern
- Das "Unbekannte" ist bedrohlich
- Angst gewisse Erungenschaften aufzugeben müssen
4. 7 Werbung
- Nähe bei attraktiver Frau
- Bedürfnis nach Partnerschaft
- Geborgenheit
- Appell an Patriotismus
- Bohren in Unsicherheiten
- Abbauen von Aggressionen durch: Lächeln, Kopf schräg halten
- Technik
- Weltraum (baut auf Lernprozess auf)
- Tierschutz
- aktuelle Themen
- Sicherheit
- Ersatz für etwas
- Wiederholung
- Signete
- Leute bei der Ehre nehmen